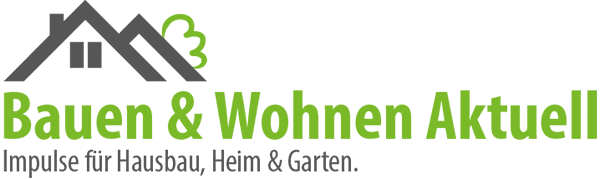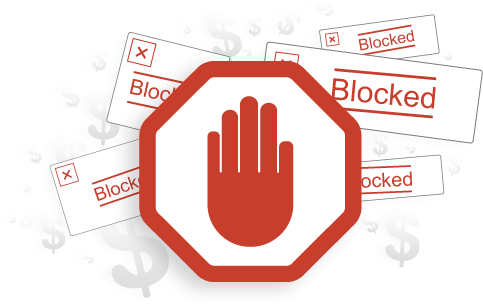Wohnungsbau zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Bauen & Wohnen aktuell spricht mit Bernd Patzke über den „Bau-Turbo“ der Bundesregierung

Am 19. Juni hat die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz, den Bau-Turbo angekündigt. In einer Pressemeldung des Ministeriums heißt es: „Wir zünden den Bau-Turbo, weil jede Wohnung zählt. Die Planung und Genehmigung von Bauprojekten dauert in Deutschland zu lange. Gerade, wenn es darum geht, Wohnraum zu schaffen, müssen wir deutlich schneller werden. Darum ist der Bau-Turbo die Top-Priorität des Bauministeriums zum Start dieser Wahlperiode. Mit dem Bau-Turbo machen wir den Weg frei für mehr Tempo im Wohnungsbau und für mehr bezahlbaren Wohnraum. Zusätzlich schützen wir mit der Verlängerung des Umwandlungsschutzes den Bestand an Mietwohnungen.“
Doch wie sieht die Realität in der Praxis aus? An was scheitert das Ziel von 400.000 Wohnung jährlich tatsächlich? Diese und andere Fragen hat Bauen & Wohnen aktuell einem Experten gestellt: Bernd Patzke.
Bernd Patzke ist Inhaber und Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft Patzke GmbH – Büro für Bauwesen (IGP) mit Sitz in Soest ist seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe bei der Planung und Überwachung anspruchsvoller Infrastrukturprojekte. Darüber hinaus ist die IGP anerkannter Partner bei komplexen Erschließungsmaßnahmen von Wohngebieten und Gewerbeflächen.
Herr Patzke, was macht aus Ihrer Sicht das Bauen von Wohnungen so teuer und so komplex, dass man die Zahl von 400.000 Wohnungen nicht erreicht? Welche Zahl ist aus Ihrer Sicht realistisch?
Der Wohnungsbau leidet unter einem Mix aus hohen Baukosten, strengen Auflagen, langwierigen Genehmigungen und gestiegenen Finanzierungskosten. Energieeffizienz, Schallschutz, Barrierefreiheit – all das hat seinen Sinn, verteuert aber den Bau. Hinzu kommt: Die Bauwirtschaft kalkuliert mit immer dünneren Margen, während Material- und Lohnkosten steigen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sind kaum machbar. Realistisch erscheint eher ein Ziel zwischen 200.000 und 250.000 Einheiten, und das auch nur, wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern.
Was unterscheidet den Wohnungsbau von anderen Baumaßnahmen? Was sind die besonderen Herausforderungen, weswegen dieses Thema nicht im gleichen politischen Kontext diskutiert wird wie etwa zerfallende Brücken oder marode Straßen? Könnte man das nicht über das Infrastrukturpaket lösen?
Im Gegensatz zu Infrastruktur- oder Gewerbebauten steht der Wohnungsbau unter ständiger Beobachtung: Jede neue Baumaßnahme ist unmittelbar spürbar für Anwohner. Zudem fehlen beim Wohnungsbau oft große Trägerstrukturen, wie sie etwa der öffentliche Hochbau kennt. Und: Wohnraum ist sozial aufgeladen – es geht um Nachbarschaft, um Integration, um Lebensqualität. Deshalb steht er in einem anderen politischen Kontext als etwa Brückensanierungen.
Welche Rollen spielen Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren, wenn man über Wohnungsmangel spricht?
Das Genehmigungsdickicht ist real: Unterschiedliche Landesbauordnungen, parallele Umwelt- und Denkmalschutzvorgaben, überforderte Bauämter, analoge Verfahren. All das verzögert den Wohnungsbau teils um Jahre. Digitalisierung, Standardisierung und eine bessere Personalausstattung könnten hier viel bewegen.
Wer sind die Bremser? Die einen zeigen auf die Kommunen, etwa, wenn es um die Ausweisung von Flächen oder Genehmigungen geht, andere auf die verschiedenen Bauordnungen und damit auf die Länder, und wieder andere auf die Anwohner, die sich gegen neue Bauvorhaben in ihrer Nachbarschaft wehren. Wie ist das Zusammenspiel und wie erleben Sie das in Ihrer Praxis?
Das Zusammenspiel ist komplex: Kommunen tun sich oft schwer mit der Ausweisung neuer Flächen – aus Angst vor Protesten. Die Länder tragen mit zersplitterten Bauordnungen zur Intransparenz bei. Und die Anwohner sind oft lautstark, gut vernetzt und wissen, wie man Projekte zu Fall bringt. In der Praxis erleben wir regelmäßig, dass Projekte mit Rückhalt auf Landes- oder Bundesebene lokal blockiert werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Meistens geht es darum, die althergebrachte soziale Ordnung der Nachbarschaft so zu erhalten, wie sie gerade ist. Es ist ein bisschen das Sankt-Florian-Prinzip: neue Wohnungen gerne, aber doch nicht ausgerechnet hier.
Wie erleben Sie das Problem in Soest und in den Städten, in denen Sie aktiv sind? Ist das „auf dem Land“ auch ein Thema oder nur in Ballungsräumen?
In Soest zeigt sich: Auch im ländlichen Raum ist Wohnraumbedarf vorhanden – vor allem für junge Familien und ältere Menschen. Anders als in Großstädten geht es weniger um Verdichtung, sondern um bezahlbare Neubauten oder Umbauten in bestehender Struktur. Doch auch hier ist Widerstand gegen neue Quartiere spürbar.
Gibt es einen Wettbewerb um Ressourcen (Fläche, verfügbare Bauunternehmen, Ingenieurbüros oder Handwerker, Personen, die genehmigen können, Nutzungsideen für Flächen und Quartiere, …)? Wie gestaltet sich dieser Wettbewerb?
Die Konkurrenz ist groß: Fachplaner, Handwerker, Flächen, Genehmiger – alles ist knapp. Hinzu kommt: Nicht jede Fläche eignet sich für schnellen Wohnungsbau, und manche Kommunen konkurrieren aktiv um Investoren oder Baukapazitäten. Gerade kleinere Ingenieurbüros und Baubetriebe stoßen schnell an Kapazitätsgrenzen.
Wie steht es um die Unternehmen, die Wohnungen bauen (Hochbau), im Vergleich zu anderen Akteuren in der Baubranche? Wie steht es generell um die Baubranche? Man sollte meinen, da müssten jetzt alle jubilieren wegen des Geldregens aus Berlin. Andererseits: Fachkräftemangel, gestiegene Zinsen, höhere Löhne. Welche Faktoren bremsen, welche beschleunigen?
Die Branche ist gespalten: Während Teile unter Auftragsmangel leiden, sind andere überlastet. Der Fachkräftemangel ist real, ebenso wie Insolvenzen im Bauhauptgewerbe. Gestiegene Zinsen bremsen Projekte, die vor drei Jahren noch wirtschaftlich waren. Jubel sieht anders aus.
Was sind Ihre Erwartungen an die Politik in Sachen Wohnungsbau?
Wir brauchen Klarheit, Verbindlichkeit und Kontinuität. Wer baut, muss sich auf Rahmenbedingungen verlassen können. Die Forderungen sind klar: mehr Standardisierung, konsequente Digitalisierung, gezielte Förderung für bezahlbaren Wohnraum, gekoppelt an Investitionen in soziale Infrastruktur.
Was sind Ihre Tipps an Bauunternehmen in Sachen Zukunftsplanung?
Jetzt ist die Zeit für Spezialisierung, wie zum Beispiel auf serielle Bauweisen, Bestandssanierung, Kooperationen mit Kommunen. Quartiersentwicklung statt Einzellösungen. Wer flexibel bleibt, digital arbeitet und lokal vernetzt ist, hat die besten Chancen, auch in unsicheren Zeiten erfolgreich zu bauen.
Veröffentlicht von:

- Alexandra Rüsche gehört seit 2009 der Redaktion Bauen-Wohnen-Aktuell.de an. Sie schreibt als Journalistin über Hausbau, Inneneinrichtung, Energiesparen, Gartengestaltung, Pflanzen und Haustiere, sowie Innovationen. Alexandra ist Mitglied im DPV (Deutscher Presse Verband - Verband für Journalisten e.V.). Sie ist über die Mailadresse der Redaktion erreichbar: redaktion@bauen-wohnen-aktuell.de
Letzte Veröffentlichungen:
 Bauen14. Juli 2025Wohnungsbau zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Bauen14. Juli 2025Wohnungsbau zwischen Anspruch und Wirklichkeit Wohnen10. Juli 2025Saugen und Wischen mit dem FLOOR ONE S5 Stretch Extreme von Tineco
Wohnen10. Juli 2025Saugen und Wischen mit dem FLOOR ONE S5 Stretch Extreme von Tineco Garten & Outdoor4. April 2025Zukunftsbäume für den Garten
Garten & Outdoor4. April 2025Zukunftsbäume für den Garten Bad4. April 2025Saunagenuss auf kleinstem Raum
Bad4. April 2025Saunagenuss auf kleinstem Raum